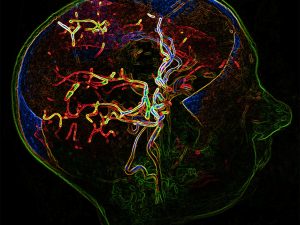Weshalb ist es problematisch, wenn Entscheidungen nicht frühzeitig getroffen werden?
Katharina Bronner: Die Alzheimer-Erkrankung ist eine chronisch fortschreitende Erkrankung ohne Möglichkeit auf Stillstand oder Heilung. Im Verlauf verschlechtert sich das Denk- und Urteilsvermögen und der Erkrankte verliert seine Entscheidungsfähigkeit. Alle Entscheidungen, die getroffen werden müssen und die der Betroffene nicht im Voraus geplant und bestimmt hat, werden dann von jemand anderem getroffen – mitunter sogar von Menschen, die den Betroffenen kaum kennen. Das birgt einerseits die Gefahr, dass die Wünsche und Vorstellungen des Erkrankten falsch umgesetzt werden, und andererseits, dass die Angehörigen und die Behandelnden nicht auf schwierige Situationen vorbereitet sind und dadurch überfordert werden können.
Wer entscheidet bisher, wann ein Patient als nicht mehr entscheidungsfähig gilt? Und wie sind diese Dinge rechtlich geregelt?
Katharina Bronner: Die Entscheidungsunfähigkeit ist in Deutschland zivilrechtlich im Bürgerlichen Gesetzbuch geregelt. Wichtig ist zu wissen, dass Angehörige nicht automatisch für den Erkrankten entscheiden dürfen. Wurde keine Person zuvor bevollmächtigt, setzt das Betreuungsgericht einen rechtlichen Betreuer ein. Das kann ein Angehöriger sein, aber auch eine für den Betroffenen vollkommen unbekannte Person. Mit einer Vorsorgevollmacht hat jeder die Möglichkeit, sich seinen Stellvertreter auszusuchen, der bei Entscheidungsunfähigkeit sofort handeln kann. Alternativ kann man in einer Betreuungsverfügung einen rechtlichen Betreuer vorschlagen, der dann aber erst durch das Gericht bestellt werden muss. Liegt eine ausführliche, rechtlich gültige Patientenverfügung vor, die ärztliche Maßnahmen bei Einwilligungsunfähigkeit regelt, ist diese unmittelbar zu beachten, auch wenn es (noch) keinen Stellvertreter gibt.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration