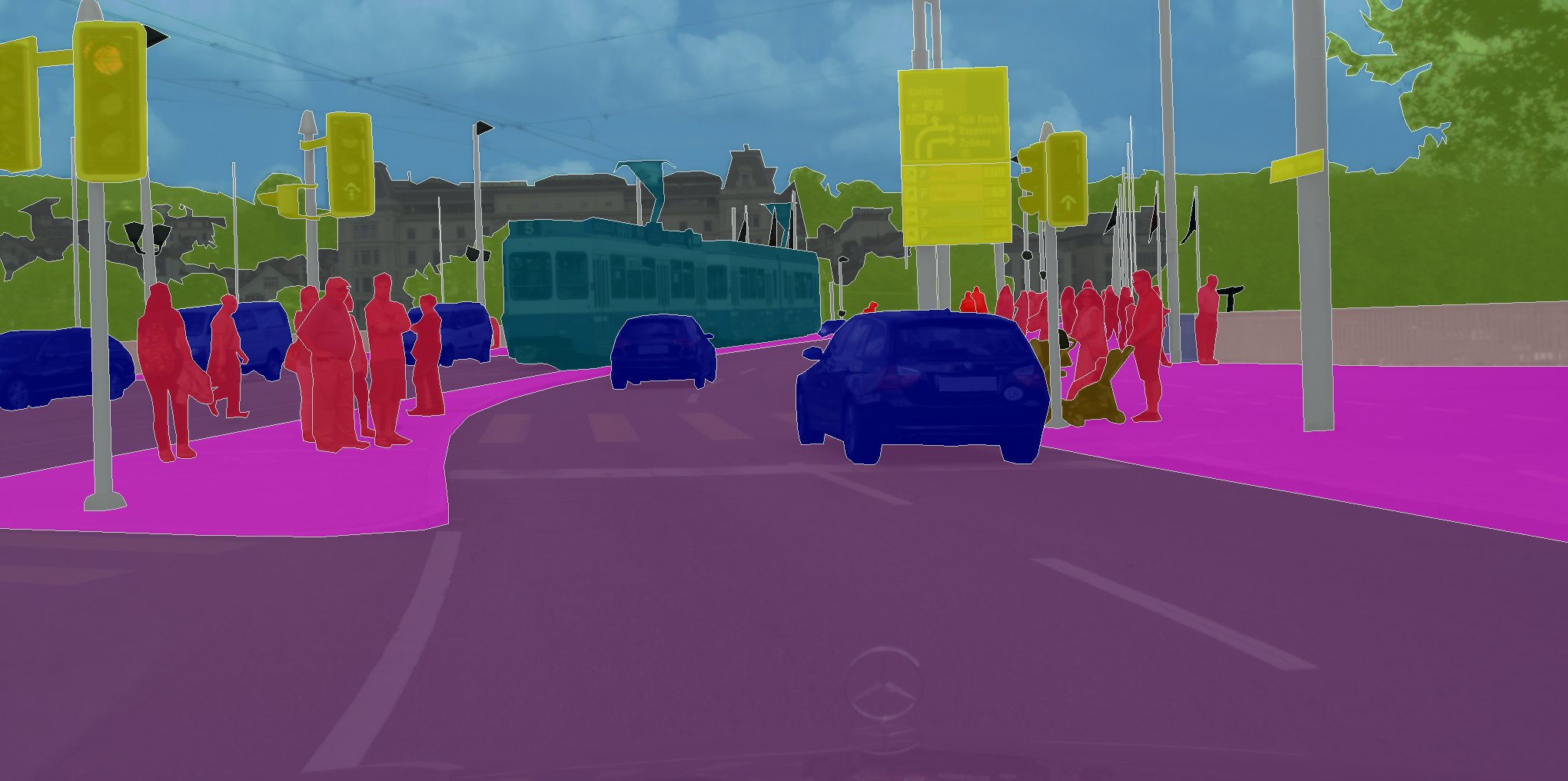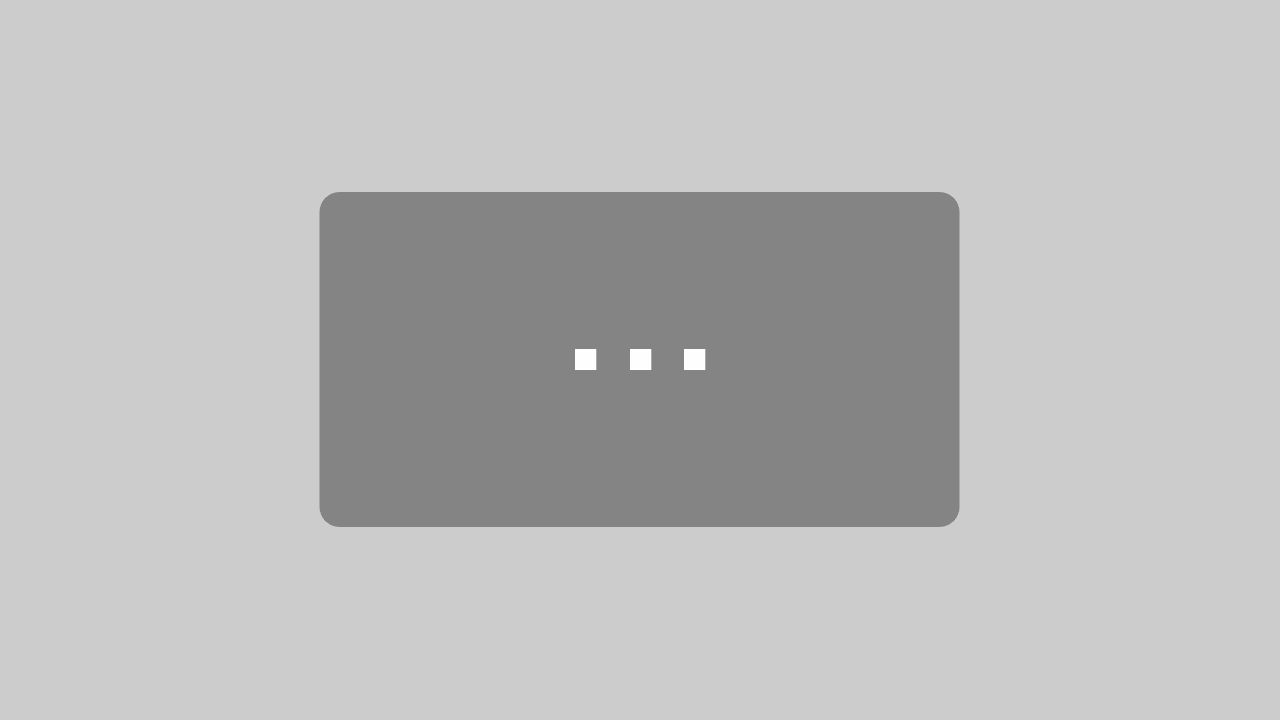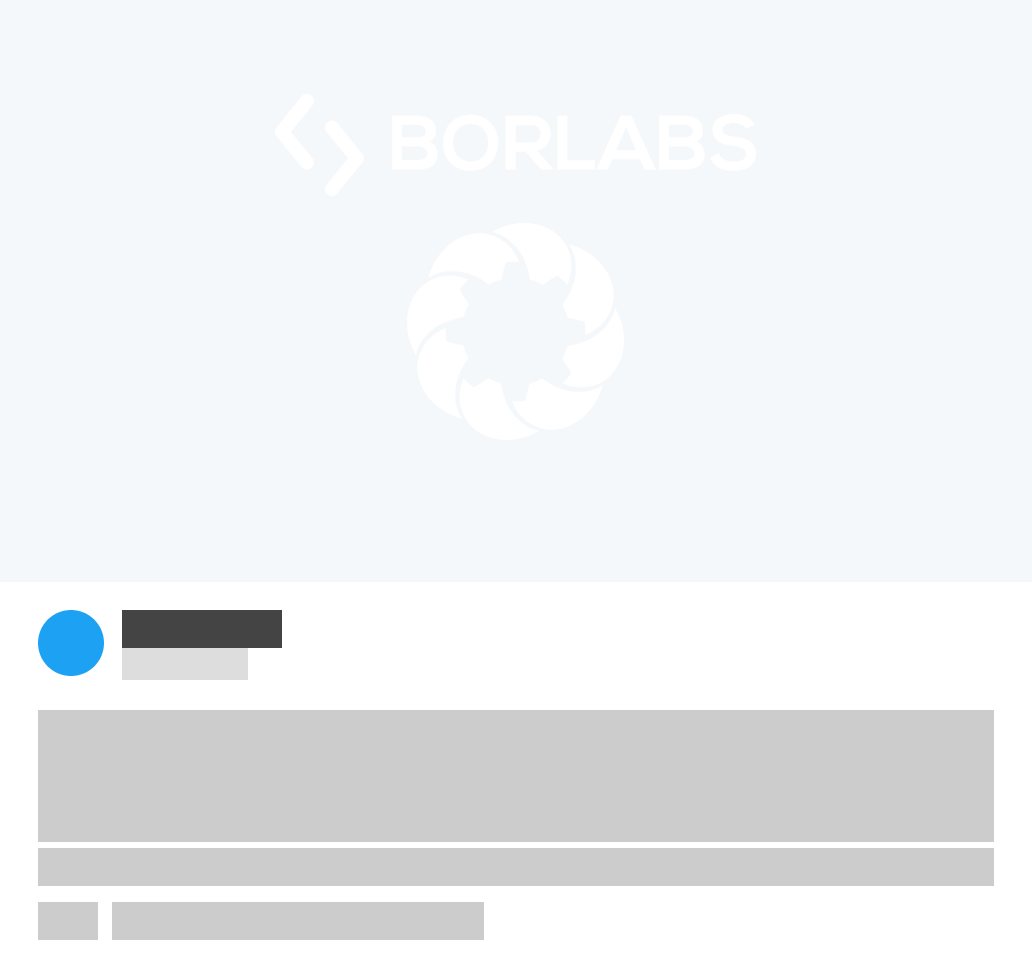Während das Auto sicher ans Ziel fährt, drehen die Insassen in den Lounge-Chairs gemütlich die Sitze zu den Mitfahrern, unterhalten sich, schreiben E-Mails oder lesen ein Buch. Solche Versprechen mit Bildern erster Prototypen der Automobile der Zukunft werden derzeit von der Autoindustrie und Entwicklern wie Elon Musk verbreitet.
Schon bald sollen wir uns im Auto bequem und sicher zurücklehnen können und die freie Zeit für sinnvollere Beschäftigungen nutzen als die Aufmerksamkeit ständig auf die Straße richten zu müssen. Zugleich verstören uns Nachrichten von Unfällen, in die autonome Fahrzeuge verwickelt sind. Sie schüren Zweifel an der Reife der Technologie und werfen legitime Fragen auf: Wie weit ist die wissenschaftliche und technische Entwicklung auf dem Weg zum autonomen Fahren tatsächlich? Stehen wir kurz vor der flächendeckenden Einführung oder bleibt das alles Zukunftsmusik?
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration