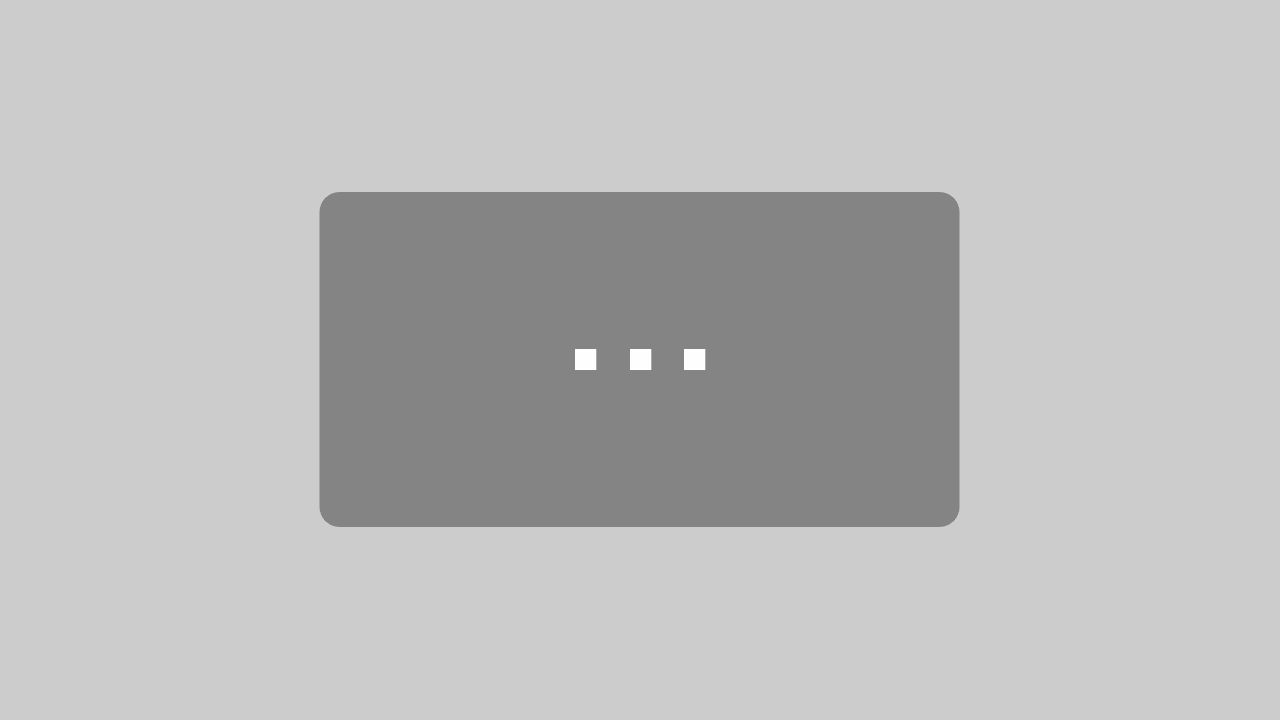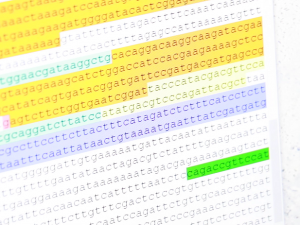Bei der neuen Technologie CRISPR/Cas sind diese Gesetze jedoch nicht mehr eindeutig zu interpretieren. Denn definiert werden GVO sowohl in der deutschen als auch in der europäischen Gesetzgebung als Organismen, in denen genetische Veränderungen vorgenommen wurden, die natürlicherweise durch Kreuzung und Rekombination nicht hätten entstehen können. Eine heikle Definition, wenn man sich die Änderungen anschaut, die durch CRISPR/Cas mittels Punktmutation – also dem Austausch eines einzelnen Bausteins der DNA – entstehen können. Bei dem neuen Vorgehen lässt sich im Nachhinein oft nicht mehr nachvollziehen, ob das Erbgut einer Pflanze im Labor gezielt verändert wurde oder durch herkömmliche Züchtungsmethoden entwickelt wurde. Entscheidend ist daher an dieser Stelle die Diskussion, ob man den Prozess der Herstellung oder das fertige Produkt an sich betrachtet, wenn man über die Definition von GVO diskutiert.
„Wenn man unserer Rechtsauslegung folgen würde, wären solche Pflanzen, die natürlicherweise hätten entstehen können und die nicht von natürlichen Mutationen zu unterscheiden sind, keine GVO. Man könnte sie wie normale Zuchtpflanzen behandeln”, sagt Prof. Dr. Detlef Bartsch, Leiter der Abteilung Gentechnik im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), welches sich in einer Stellungnahme intensiv mit der Einordnung von eben solchen Züchtungstechniken befasst hat.
Darin wird betont, dass sich die Definition der GVO im Gentechnikgesetz der EU nicht ausschließlich auf den Prozess der Veränderung beziehe. Hingegen, so die Argumentation des BVL, sei vielmehr auch das Produkt für die Betrachtung entscheidend. „Bei CRISPR/Cas würden wir bei der Bewertung sagen, dass es im Einzelfall darauf ankommt, was man damit macht. Wenn die genetischen Auswirkungen nicht weitreichender sind als in der klassischen Mutationszüchtung und dementsprechend beide Züchtungsprodukte nicht unterscheidbar sind, warum sollte man das unterschiedlich regeln? Das wäre diskriminierend“, sagt Bartsch.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration