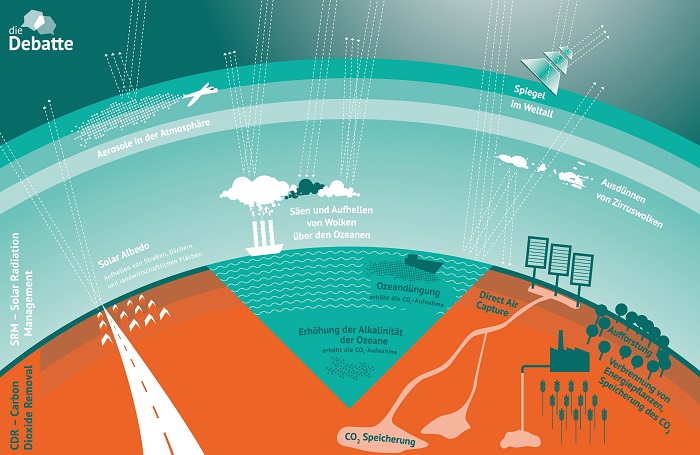Eine der diskutierten Methoden sieht vor, die Ozeane mit Eisenspänen als Mikronährstoff zu düngen und so ein stärkeres Algenwachstum auszulösen. Der Effekt: Die Algen würden mehr Fotosynthese betreiben und dadurch auch mehr CO2 aus der Atmosphäre binden und speichern. Zwar haben bereits mehrere Freilandexperimente stattgefunden, doch die Methode gilt als kompliziert und riskant. „Die Zusammenhänge im Ozean sind sehr komplex, sodass man weder die Effektivität, noch die möglichen Nebenwirkungen wirklich abschätzen kann”, sagt Sonntag.
Alternativ ließe sich auch die Alkalinität – also das Säurebindungsvermögen – des Ozeans künstlich erhöhen und dadurch mehr Kohlenstoff im Wasser selber speichern. Dazu würde Gesteinspulver in den Ozeanen verteilt werden, das die chemische Reaktion auslöst. In die Praxis hat es diese Methode bisher allerdings nicht geschafft. Zwar wird das Potential zur CO2-Reduzierung als recht hoch eingeschätzt, aber auch die Nebenwirkungen für das Ökosystem sind potentiell gravierend. „Mit dieser Methode würde man das gesamte chemische Gleichgewicht der Ozeane unter anderem den pH-Wert verändern und das hätte Folgen für sämtliche darin lebenden Organismen”, sagt Sonntag.
Andere Ansätze des CDR setzen hingegen auf dem Land an. So gibt es die Idee, künstliche Bäume zu schaffen, die mittels chemischer Verfahren das CO2 aus der Luft binden. Ein erstes kommerzielles Projekt der sogenannten Direct Air Capture-Technologie ist bereits im Sommer 2017 in der Schweiz zur kommerziellen Anwendung gekommen. „Die Schwierigkeit bei Direct Air Capture ist, dass die Technologie insgesamt sehr energieaufwändig und noch recht teuer ist”, sagt Dr. Jessica Strefler vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Da die Direct Air Capture-Anlagen das CO2 zwar einfangen, aber nicht dauerhaft speichern können, verbindet man den Technologieansatz mit dem des Carbon Capture and Storage (CCS) – eine Technologie zum Verflüssigen und langfristigen Verpressen von CO2 in den Boden. CCS ist dabei keine eigene Geoengineering-Technologie, sondern einstmals entwickelt worden, um das bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe freiwerdende CO2 nicht in die Atmosphäre zu entlassen. Im Zuge der Diskussion um negative Emissionstechnologien kommt dieser Methode nun eine neue Bedeutung zu. „CCS bietet die Möglichkeit, das CO2 wirklich langfristig zu speichern und kann daher zum Beispiel Emissionen aus Industrieprozessen reduzieren”, sagt Strefler. „Vor allem in Verbindung mit CDR-Technologien werden wir um den moderaten Einsatz von CCS kaum herumkommen, wenn wir die vereinbarten Klimaziele tatsächlich erreichen wollen.”
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration