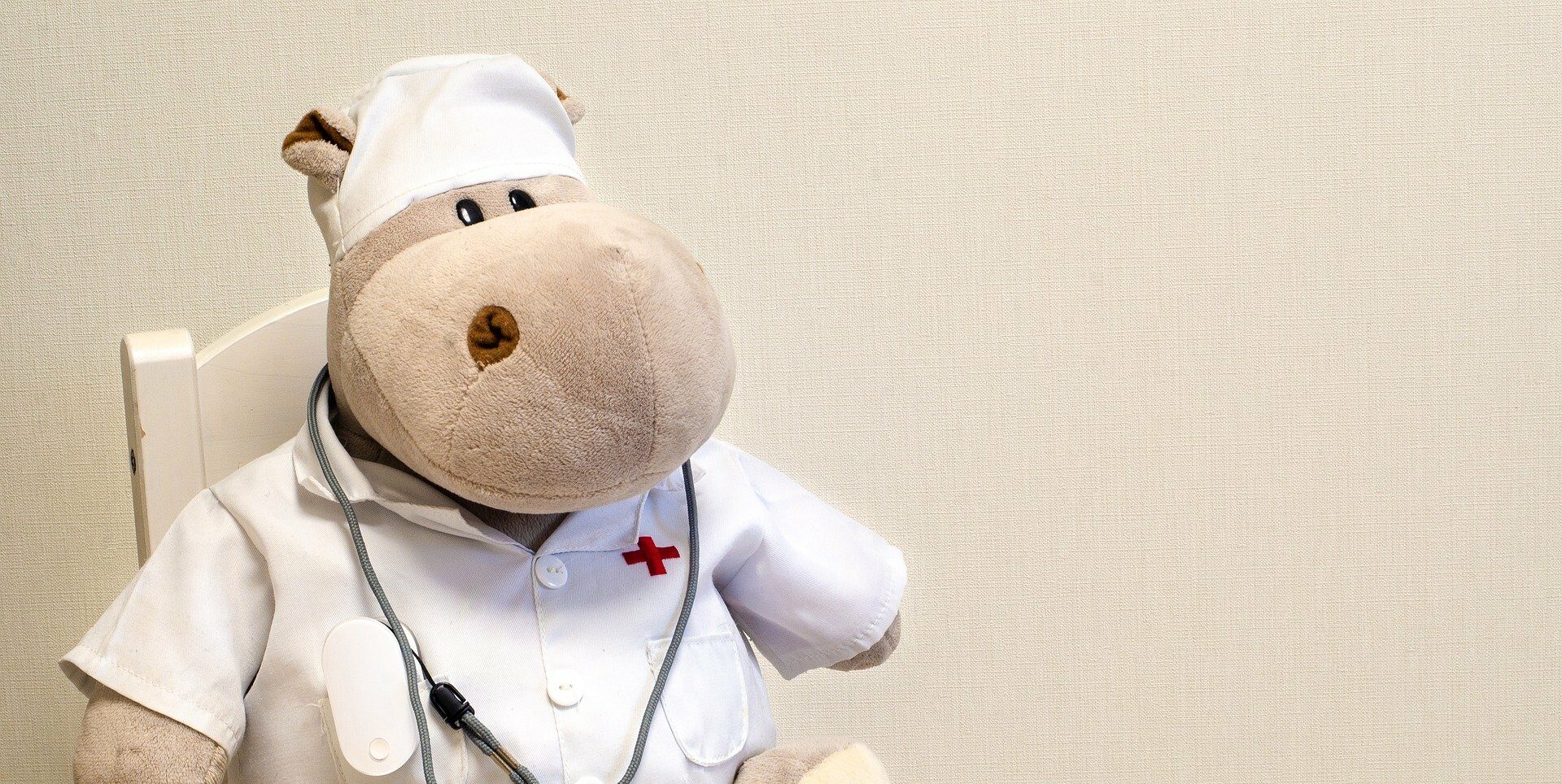Dem Soziologen liegt daran, den Zusammenhang zwischen Kinderarmut und Gesundheit nicht zu mechanistisch zu betrachten. Geldsorgen können zu Stress in Familien führen und Kinder psychisch belasten, sie erhöhen das Risiko für eine schlechtere Ernährung und weniger Bewegung. Doch dies ist kein zwangsläufiger Zusammenhang. Vielmehr hat Armut viele Gesichter: Milieu, Bildung und berufliche Stellung der Eltern können den negativen Effekt eines niedrigen Einkommens deutlich ausgleichen. „Manche kaufen mit geringem Einkommen Vollkornbrot und frisches Gemüse, andere Fast Food, das genauso viel kostet.“
Umgekehrt bedeutet dies, dass ein höheres Einkommen oder staatliche Förderungen die Gesundheit der Kinder in sozial schwachen Familien nicht automatisch verbessern würde. „Mit mehr Geld allein lässt sich der Zusammenhang nicht knacken“, ist Andreas Klocke überzeugt. Wer keinen Wert auf eine gesunde Ernährung legt, wird sich vermutlich auch nicht durch finanzielle Zuschüsse zum täglichen Kochen bewegen lassen.
Also muss man Kinder und Jugendliche aus Haushalten mit geringem Einkommen außerhalb der Familien erreichen, um ihr Gesundheitsverhalten zu fördern. „Kita und Schule sind die prägenden Lebenswelten, in denen man sinnvoll Prävention betreiben kann“, sagt Benjamin Kuntz. Hier kann man Kindern aller Herkunftsgruppen ein ausgewogenes Essen, Bewegungsangebote, Anti-Mobbing- und Anti-Gewalt-Trainings bieten. In den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen können so familiäre Defizite ausgeglichen werden, sind Forscher*innen überzeugt. Vorausgesetzt man räumt ihnen den notwendigen Stellenwert ein und stattet sie finanziell entsprechend aus.
Ein weiterer Vorteil: In diesen öffentlichen Räumen erreicht man die Heranwachsenden schneller und direkter als durch Versuche, das Verhalten von Eltern im häuslichen Bereich zu beeinflussen. Je früher diese Präventionsprogramme ansetzen, desto eher besteht die Chance, ungesunde Verhaltensmuster erst gar nicht zu verfestigen. Wer als Kind lernt, auf eine gesunde Ernährung, Sport und psychischen Ausgleich zu achten, nimmt diese Erfahrung in sein späteres Leben mit. Und gibt sie im besten Fall an seine eigenen Kinder weiter.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration