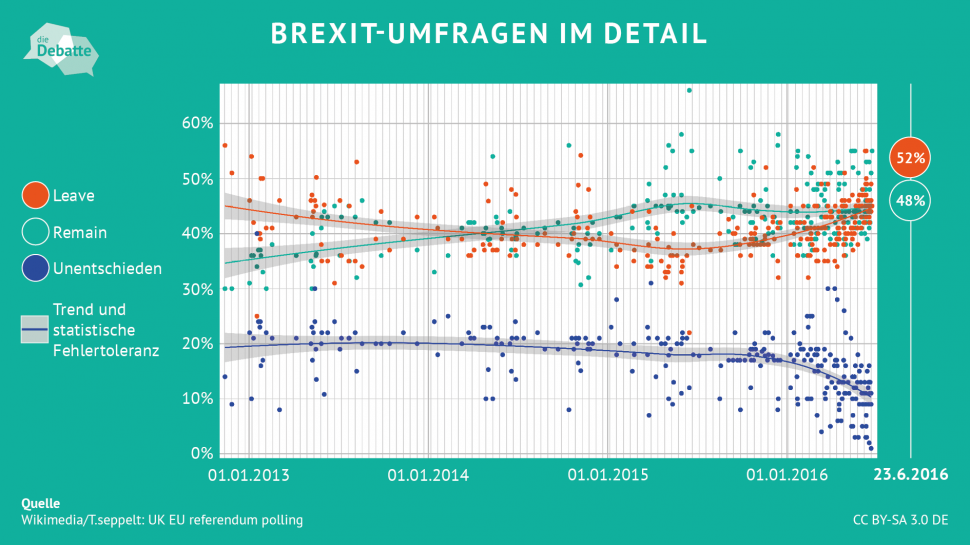Verliert man nicht die Inhalte aus dem Blick, wenn man sich so sehr auf die Zahlen konzentriert?
Den Vorwurf hört man immer wieder, wir haben versucht diesen Punkt bewusst zu berücksichtigen. Mein Mitgründer Dominik Wurnig und ich haben uns am Anfang das Ziel gesetzt, dass wir „weniger schlecht” vorhersagen wollen. Uns ist immer wichtig, nicht mit einer Attitüde aufzutreten, dass wir wissen, was passiert. Wir wollen ganz bewusst den Punkt machen, dass man vorsichtig sein muss und wir wollen die Hintergründe der Zahlenspielereien erklären und verdeutlichen, warum das ein kompliziertes Geschäft ist.
Was läuft Ihrer Meinung nach falsch in der Umfrageforschung?
Ehrlich gesagt läuft weniger in der Forschung etwas falsch als in der Präsentation in den Medien und beim Verständnis in der Bevölkerung. Man muss sich einfach klar machen, dass Umfragen nicht auf einen zehntel Prozentpunkt vorhersagen können, wie das Rennen ausgeht. Umfragen können immer nur eine Stichprobe einbeziehen und es ist schwer, Werte beziehungsweise Meinungen von bestimmten Bevölkerungsteilen zu erheben. Das prognostizierte Ergebnis kann immer plus oder minus zwei Prozentpunkte von der Realität abweichen.
Auch die Debatte um die angeblich falschen Vorhersagen bei der Trump-Wahl und beim Brexit wird nicht wirklich richtig geführt. Wissenschaftlich und quantitativ lagen die Umfragewerte in Wirklichkeit nämlich ganz gut. Beide Male war das Problem, dass man sozusagen qualitativ daneben gelegen hat und gesagt hat, dass die andere Seite gewinnt. Bei Clinton und Trump ist es letztendlich so gewesen, dass 70.000 Leute in drei Bundesstaaten die Wahl entschieden haben. Das kann man in Umfragen nie erfassen.
Solche Systeme haben immer auch Grenzen, weil sonst die Befragung viel zu lange dauern oder zu teuer würde. Unterm Strich ist mein Eindruck, dass man den Umfrageinstituten maximal vorwerfen kann zu wenig herauszuarbeiten, wie fehlbar sie sein können. Aber sie treffen auch auf ein Publikum, das ihnen nur allzu gerne glaubt.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration