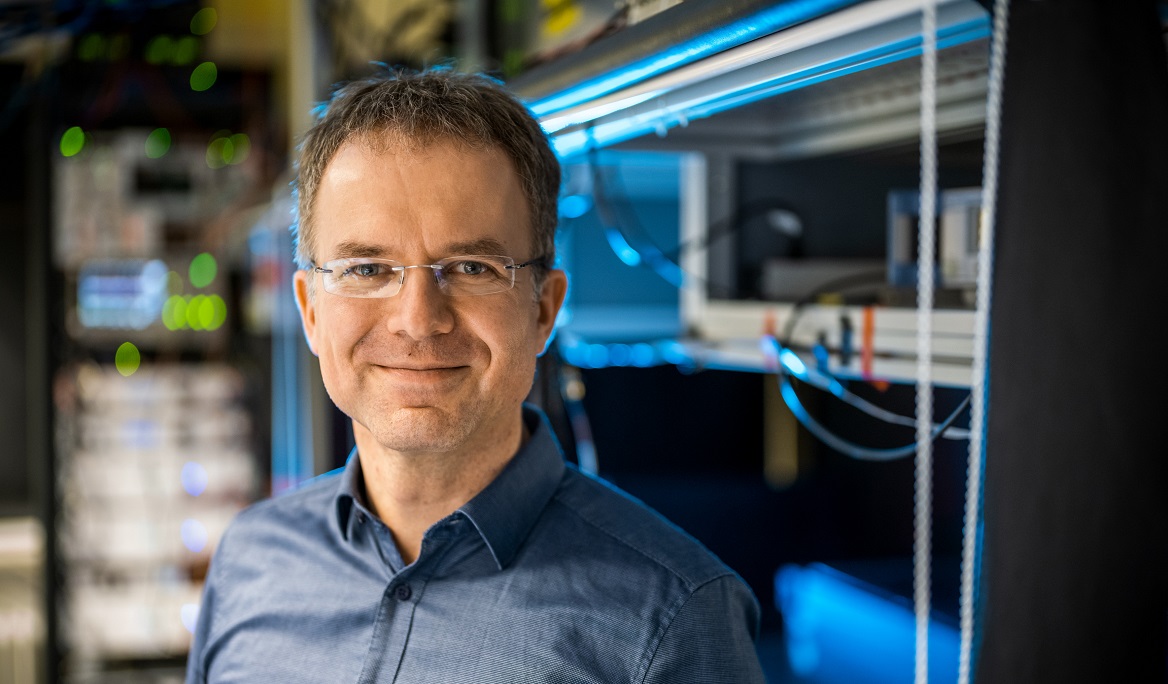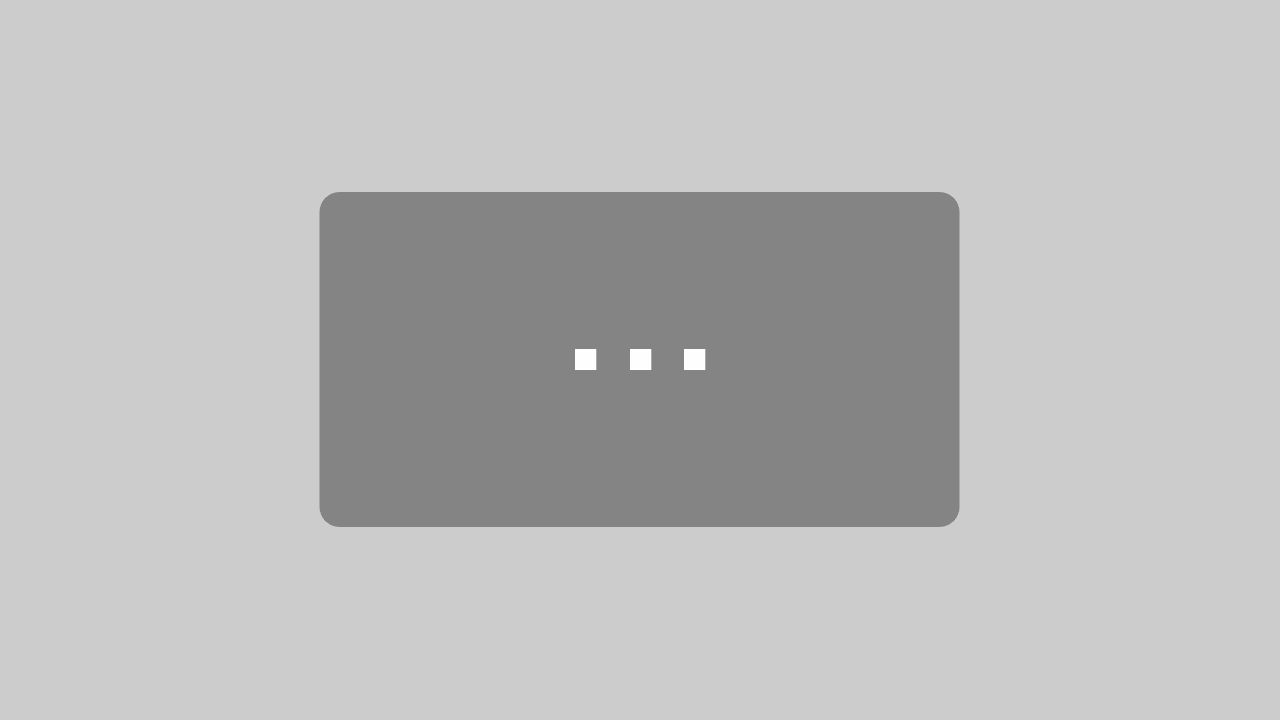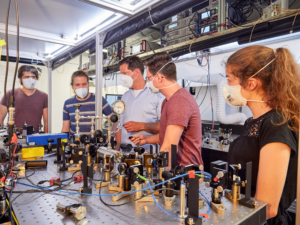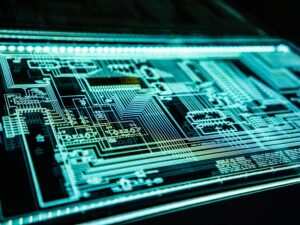Quantencomputer können auf verschiedenen Architekturen basieren. Dabei werden jeweils unterschiedliche Methoden angewendet, um Qubits zu erzeugen. Sie arbeiten mit Ionenfallen. Wie funktionieren diese Fallen?
Die Frage ist immer: Was verwendet man als Qubit und wie manipuliert man das dann? Wir verwenden Berylliumionen als Qubits. Das sind Berylliumatome, denen man ein Elektron weggenommen hat. Die Qubits muss man nun irgendwie festhalten können, und das macht man mit einer sogenannten Ionenfalle. Die Falle besteht aus unterschiedlichen Metallteilen, die auf unterschiedlichen Spannungen liegen und so elektrischen Felder erzeugen. Mithilfe dieser elektrischen Felder kann ein Teilchen eingefangen werden.
Um die Qubits zu manipulieren und so mit ihnen zu rechnen, verwenden wir Mikrowellenimpulse. Das sind im Prinzip Radiosignale, wie man sie auch in Mobiltelefonen verwendet. Und damit die Qubits nicht ständig mit anderen Atomen, beispielsweise Sauerstoff Stickstoff, die ja auch noch hier im Raum unterwegs sind, reagieren, findet das Ganze in einem Vakuum statt. So können wir die Qubits für längere Zeit speichern und manipulieren.
Welche Vorteile bietet die Ionenfalle gegenüber anderen Quantencomputer-Architekturen, beispielsweise dem Supraleiter?
Das Besondere an den Ionenfallen ist, dass sie bei Raumtemperatur funktionieren. Gekühlt werden müssen lediglich die Ionen, dafür nutzen wir Laserstrahlen. Die Laserkühlung ermöglicht es uns, die Ionen auf so tiefe Temperaturen zu bringen, dass jegliche Bewegung in ihnen ausgefroren ist. Und dass, obwohl sämtliche Umgebung der Ionen auf Raumtemperatur ist.
Darüber hinaus kann man in dieser Architektur bei den Qubits extrem langlebige Zustände erzielen. Die Qubits in unserem Labor leben minutenlang, bevor sie dekohärieren, also bevor die Überlagerungszustände kaputtgehen. Sobald die Qubits dekohäriert sind, sind sie für uns nicht mehr nützlich. Wir haben hier mit unserer Technologie eine Dekohärenzzeit im Minutenbereich, während die Rechenoperationen sich im Bereich von hunderten Mikrosekunden befinden. Die Speicherzeit steht also in einem sehr guten Verhältnis zur Rechenzeit.
Gibt es weitere Vorteile?
Was außerdem für die Ionenfallen-Architektur spricht, ist die Qualität der Rechenoperationen: Ionen sind bisher das System mit dem niedrigsten Fehler bei den Rechenoperationen. Das ist dann relevant, wenn man das System skalieren möchte, also mit ganz vielen Qubits rechnen möchte. Dabei muss der Fehler, den man bei einzelnen Rechenoperationen macht, möglichst klein sein.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration