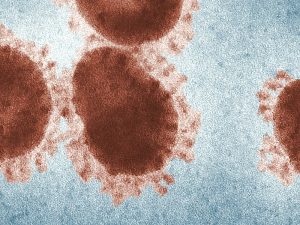Welche Rolle spielen die Aussagen von Autoritäten für unser Verhalten oder das Empfinden von Angst?
Das spielt eine sehr große Rolle. Wenn das Gefühl besteht, dass die Politik mit Plan handelt und uns Schutz bietet, dann entsteht Vertrauen. Man sieht ja sehr klar, dass hier auch unterschiedliche Mittel der Ansprache gewählt werden, je nach Land und Regierungschef und diese unterschiedlich wirken. Auch die Medien haben eine wichtige Funktion, weil der Bedarf an vertrauenswürdigen und wissenschaftlich gesicherten Informationen da ist. Das steigende Interesse an den öffentlich-rechtlichen Medien belegt dies.
Gleichzeitig sehen wir aber vor allem in den Sozialen Medien, dass viele zusätzliche Botschaften kursieren. Hier zirkulieren Informationen über die Krankheit, die oft falsch sind – die Menschen aber das Gefühl von Sicherheit vermitteln, etwas tun zu können. Verschwörungstheorien wiederum liefern eine Sinnerzählung: Sie geben der Krankheit eine tiefere Bedeutung, die wissenschaftliche Fakten allein nicht liefern und die viele suchen.
Die erste Assoziation mit Angst ist häufig eine negative, gibt es auch eine positive Seite von Angst?
Angst ist definitiv vieldeutig. Angst hat eine wichtige Funktion dafür, dass wir versuchen, uns und unsere direkte Umgebung zu schützen. Das ist per se erstmal positiv. Das kann aber natürlich auch kippen und zu unsozialen Verhaltensweisen führen. Aktuell sieht man, dass bestimmte moralische Verbindlichkeiten und ethische Werte teils wegfallen. Hamsterkäufe oder das Stehlen von Desinfektionsmitteln sind zwei Beispiele dafür, wie sonst gültige Normen in Frage gestellt oder sogar außer Kraft gesetzt werden. Das kann mit Angst oder Panik zu tun haben – ist aber natürlich im Fall von Diebstahl vor allem ein krimineller Akt.
Auf der anderen Seite kann aber durch Angst auch Solidarisierung entstehen. Sobald wir merken, dass wir uns selbst und unser direktes Umfeld schützen können, solidarisieren wir uns auch mit anderen, die dem Krankheitsrisiko noch stärker ausgesetzt sind. Das sehen wir bei allen negativen Seiten derzeit ebenfalls – sowohl innergesellschaftlich als auch im Ansatz über Ländergrenzen hinweg. Hier wirkt Angst quasi als verbindendes Element.
Es gibt ja bereits länger Warnungen dazu, dass globale Pandemien auftreten könnten. Weshalb hat uns der Ausbruch doch so überrascht?
Prognosen über Krisen sind generell nicht leicht nachhaltig zu kommunizieren. Ein ähnliches Phänomen beobachtet man ja beispielsweise beim Klimawandel, wo es neben vielfachen Bedrohungsszenarien sogar bereits greifbare Schäden gibt – die Bereitschaft selbst etwas dagegen zu tun, aber nur langsam ankommt. Im Fall von Corona kommt hinzu, dass frühere, potentiell grenzüberschreitende Krankheiten wie Ebola oder SARS uns in Nordeuropa nicht wirklich betroffen haben. Ich denke, dass sich das durch die Corona-Pandemie verändern wird. Sie führt uns vor Augen, dass wir in Deutschland für globale Infektionskrankheiten verletzlich sind. Das wird sich in unser kollektives Gedächtnis einprägen.
Für das, was in Zukunft von der Pandemie bleibt, ist aus meiner Sicht die Ebene der Mitmenschlichkeit sehr wichtig. Es wird zentral sein, wie wir innergesellschaftlich humanitäre Prinzipien – auch für die sozial Schwächsten wie Obdachlose und Geflüchtete – nicht außer Kraft setzen. Ein entscheidender Punkt ist zudem, ob es uns gelingt, internationale Solidarität und ein globales Narrativ für die Zusammenarbeit herzustellen. Ein Rückzug in nationalstaatliche und rein individuelle Lösungen ist für mich der falsche Weg aus der Krise.
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration