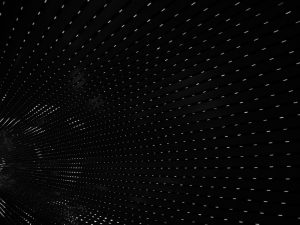Weltweit boomt der Markt der KI-Innovationen für Medizin und Pflege. Eine Vielzahl an Systemen stammt daher auch aus Ländern außerhalb Europas, wo oft schwächere Gesetze für den Datenschutz gelten. Dierks möchte aber auch hier beruhigen: „Eine Übermittlung von personenbezogenen Gesundheitsdaten in ein Land außerhalb der EU ist nur zulässig, wenn dieses auf der Liste der sicheren Drittstaaten steht oder zusätzliche Sicherungsmaßnahmen getroffen werden. Entsprechende Kontrollen können von den Aufsichtsbehörden durchgeführt werden.“ Der Rechtsexperte macht sich eher Sorgen um einen anderen Aspekt: „In Deutschland gibt es neben der DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz auch die Landesdatenschutzgesetze, die Landeskrankenhausgesetze, das Sozialgesetzbuch, das Gendiagnostikgesetz und viele weitere Vorschriften. Diese Heterogenität ist in einem vereinten Europa, in einer globalisierten Welt ein Hindernis für Forschung und Wirtschaft im internationalen Wettbewerb.“ Caspar sieht im europäischen Datenschutzsystem jedoch eher einen Vorteil: „Sofern europäische Entwickler dem Datenschutz und darüber hinausgehenden ethischen Anforderungen im gesamten Prozess der Entwicklung und Anwendung von KI Beachtung schenken, kann dies auch international als Markenzeichen einer ʻAI made in Europeʼ genutzt werden.“
Letztendlich sehen beide Experten das Selbstbestimmungsrecht des Patienten über seine Daten als zentral an. Patienten müsse die Möglichkeit gegeben werden, den Umgang mit ihren Daten zu lernen und die Verantwortung und die Möglichkeiten, diese den Akteuren im Gesundheitswesen im jeweils erforderlichen Umfang zur Verfügung zu stellen, richtig einzusetzen, sagt Christian Dierks: „Es geht nicht darum, den Datenschutz um seiner selbst willen durchzusetzen, sondern um Wissensgefälle zu vermeiden, die den Betroffenen Nachteile bescheren könnten.“ Caspar sieht den Staat in der Pflicht, Patienten bei dieser Aufgabe zu unterstützen: „Der Deutsche Ethikrat weist zu Recht darauf hin, dass sich in verantwortungsethischer Perspektive die Notwendigkeit für den Staat zum gewährleistenden, überwachenden und gegebenenfalls auch regulierenden und sanktionierenden Eingreifen umso mehr aufdrängt, je weniger Unternehmen und private Organisationen Möglichkeiten bereitstellen, dem Einzelnen die Kontrolle über seine Daten zu erleichtern. Hier kommt dem Datenschutz künftig eine wichtige Funktion zu.“
 Fleisch aus dem Labor
Fleisch aus dem Labor  CO2-Speicherung
CO2-Speicherung  Biodiversität
Biodiversität  Fracking
Fracking  Dürre
Dürre  Pränataldiagnostik
Pränataldiagnostik  Ernährungssicherung
Ernährungssicherung  Energiesicherheit
Energiesicherheit  Quantentechnologien
Quantentechnologien  Kinderarmut
Kinderarmut  Kosten des Klimawandels
Kosten des Klimawandels  Wahlverhalten
Wahlverhalten  Nudging
Nudging  Kryptowährung und Blockchain
Kryptowährung und Blockchain  Genchirurgie
Genchirurgie  Debattenkultur
Debattenkultur  Impfstoffverteilung
Impfstoffverteilung  Corona
Corona  Atomendlager
Atomendlager  Weltraumnutzung
Weltraumnutzung  Drohnen
Drohnen  Gedenkkultur
Gedenkkultur  Medikamentenentwicklung
Medikamentenentwicklung  Organspende
Organspende  Kriminalität
Kriminalität  Krankenhaus
Krankenhaus  Cannabis
Cannabis  Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz  Feinstaub
Feinstaub  Geoengineering
Geoengineering  Intelligenz
Intelligenz  Wohnungsmarkt
Wohnungsmarkt  Plastikmüll
Plastikmüll  Digitalisierte Kindheit
Digitalisierte Kindheit  Frieden
Frieden  Meinungsforschung
Meinungsforschung  Alzheimer
Alzheimer  Bienensterben
Bienensterben  E-Zigarette
E-Zigarette  Social Bots
Social Bots  Autonomes Fahren
Autonomes Fahren  Flucht und Migration
Flucht und Migration